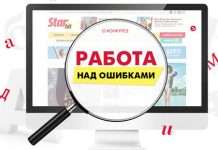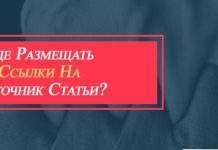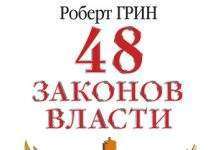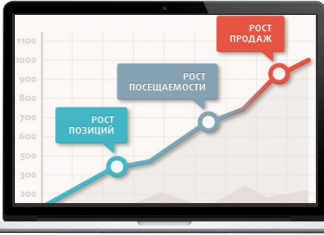Immer mehr Menschen entscheiden sich aus ethischen, ökologischen und sogar kognitiven Gründen dafür, auf generative künstliche Intelligenz (KI) – Systeme wie ChatGPT und Bildgeneratoren – zu verzichten. Diese Bewegung wird von manchen als „KI-Veganer“ bezeichnet und spiegelt tiefere Ängste vor der raschen Integration von KI in das tägliche Leben und ihren möglichen Folgen wider.
Die ethischen Bedenken: Diebstahl, Ausbeutung und Einwilligung
Das Hauptargument gegen generative KI beruht darauf, dass sie auf riesigen Datensätzen basiert, die aus bestehenden kreativen Werken stammen. Viele Künstler, Schriftsteller und Musiker haben das Gefühl, dass ihr geistiges Eigentum ohne Zustimmung ausgenutzt wird. Wie eine tschechische Künstlerin, Bella, es ausdrückte, fühlt sich der Einsatz von KI wie ein „Verrat“ an, nachdem sie jahrelang ihre Fähigkeiten verfeinert hat.
Die Ethik geht über das Urheberrecht hinaus. Marc, ein KI-Abstinenzler aus Spanien, stellt generative KI als Werkzeug zur „Arbeiterausbeutung“ dar und argumentiert, dass sie kapitalistische Systeme auf Kosten der menschlichen Kreativität aufrechterhält. Diese Bedenken sind nicht unbegründet: Das Training von KI-Modellen stützt sich häufig auf unterbezahlte Datenkennzeichner, insbesondere in Ländern wie Kenia, was Fragen zu fairen Arbeitspraktiken aufwirft.
Umweltauswirkungen: Versteckte Kosten
Über die moralischen Implikationen hinaus hat generative KI einen erheblichen ökologischen Fußabdruck. Laut einer Studie aus dem Jahr 2023 kann selbst ein kurzes Gespräch mit ChatGPT das Äquivalent einer Flasche Wasser verbrauchen. Dieser Energiebedarf erhöht den bereits erheblichen CO2-Fußabdruck von Rechenzentren und macht KI weniger nachhaltig, als viele glauben.
Kognitive Effekte: Abhängigkeit und vermindertes Denken
Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass KI auch die kognitive Entwicklung beeinträchtigen könnte. Eine aktuelle Studie des MIT ergab, dass Teilnehmer, die ChatGPT zum Schreiben von Aufsätzen nutzten, eine geringere Gehirnaktivität zeigten und Schwierigkeiten hatten, sich an ihre eigene Arbeit zu erinnern. Nataliya Kosmyna, Mitautorin der Studie, warnt davor, dass dies die Eigenverantwortung für Ideen untergraben und die Leistung in Situationen, in denen viel auf dem Spiel steht, beeinträchtigen könnte.
Diese Abhängigkeit von KI für schnelle Lösungen weckt die Befürchtung, dass die Fähigkeit zum kritischen Denken nachlässt. Lucy, eine weitere KI-Abstinenzlerin, befürchtet, dass Chatbots wahnhafte Ideen durch eine ständige Bestätigung verstärken und möglicherweise bestehende gesellschaftliche Probleme verschärfen könnten.
Die Herausforderungen der Abstinenz
Es wird immer schwieriger, KI zu vermeiden, da sie Arbeitsplätze, Schulen und soziale Medien durchdringt. Marc, ein ehemaliger KI-Cybersicherheitsexperte, beschreibt den Druck, es an der Universität einzusetzen, und die „Sucht nach Vereinfachung“ unter seinen Familienmitgliedern. Lucy steht bei ihrem Grafikdesign-Praktikum vor ähnlichen Herausforderungen, wo Kunden trotz ihrer Mängel KI-generierte Inhalte verlangen.
Die Zukunft der KI: Regulierung vs. Verbot
Für einige, wie Marc, ist die Lösung ein völliges Verbot. Andere plädieren für strengere Vorschriften, die ethische Beschaffung und faire Arbeitspraktiken in den Vordergrund stellen. Kosmyna ist der Ansicht, dass generative KI für Minderjährige verboten und Schülern in Bildungseinrichtungen nicht aufgezwungen werden sollte.
Letztendlich unterstreicht die „KI-Vegan“-Bewegung die Notwendigkeit einer sorgfältigen Abwägung der gesellschaftlichen Auswirkungen von KI. Während einige die potenziellen Vorteile erkennen, verzichten andere lieber darauf und argumentieren, dass die Kosten den Komfort überwiegen.
Die Kernbotschaft ist klar: Die Ehrfurcht vor der Realität bleibt unübertroffen. Die Neuheit der KI lässt nach und hinterlässt eine deutliche Erinnerung daran, dass menschliche Kreativität und kritisches Denken unersetzlich sind.